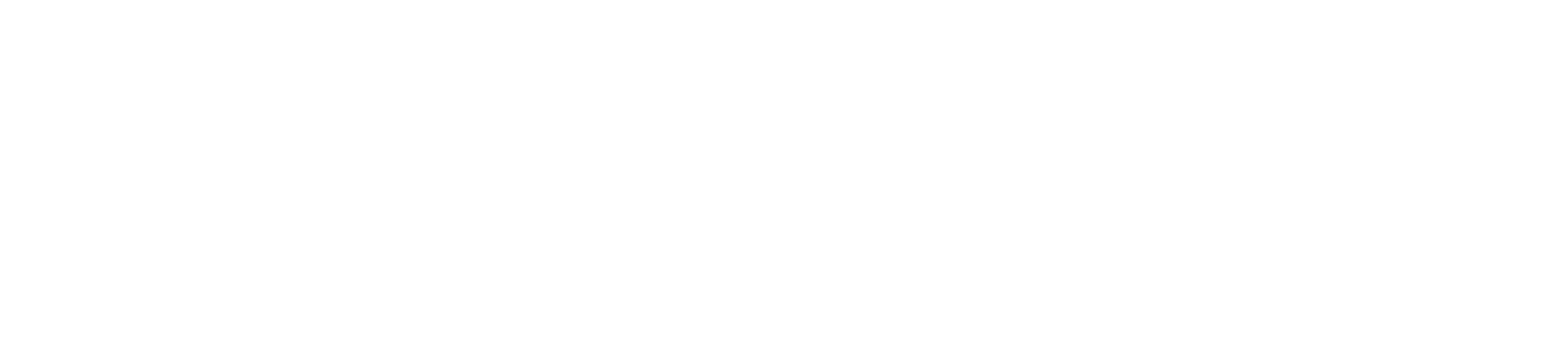
IFS & Sucht
In der IFS-Therapie wird süchtiges Verhalten nicht als Schwäche oder Charaktermangel verstanden, sondern als ein Schutzmechanismus. Bestimmte innere Anteile – sogenannte „Manager-Teile“ oder „Feuerbekämpfer“ – greifen ein, um das System vor überwältigendem Schmerz zu bewahren. Wenn die innere Not zu groß wird, übernehmen sie blitzartig die Kontrolle und betäuben Gefühle, zum Beispiel durch Alkohol, Drogen, Glücksspiel oder Essen.
Hinter dieser Dynamik stehen oft verletzte und verdrängte Anteile, sogenannte „Verbannte“. Sie tragen die Last von Scham, Einsamkeit, traumatischen Erfahrungen oder emotionaler Leere. Die Sucht schützt davor, mit diesen Gefühlen in Kontakt zu kommen – koste es, was es wolle. Deshalb ist es entscheidend, zunächst eine vertrauensvolle Beziehung zu den süchtigen Teilen aufzubauen, bevor man sich den verletzten Verbannten zuwendet.
In klassischen Ansätzen werden süchtige Teile häufig bekämpft oder ignoriert. IFS betont dagegen: Kein Teil ist schlecht. Auch die Sucht-Teile handeln aus einer positiven Absicht heraus – sie wollen beruhigen, schützen und entlasten. Erst wenn diese Absicht gewürdigt wird, können sie Vertrauen zum Selbst entwickeln und bereit werden, neue Rollen zu übernehmen.
Das Schutzsystem bei Sucht ist oft vielschichtig. Manager-Teile versuchen, das Verhalten zu kontrollieren („Nie wieder trinken“), während Feuerbekämpfer sofort eingreifen, wenn Schmerzanteile zu nahe kommen. Diese Dynamik erklärt, warum Rückfälle so automatisch und unvermeidbar wirken: Die Feuerbekämpfer haben gelernt, blitzschnell die Kontrolle zu übernehmen.
Darum geht es in der IFS-Therapie nicht darum, sofortige Abstinenz zu erzwingen. Druck würde die süchtigen Teile nur retraumatisieren und in Widerstand bringen. Stattdessen ist es hilfreicher, eine respektvolle Beziehung zu ihnen aufzubauen, sodass das Selbst ihre Last mittragen kann. Auf diese Weise verändert sich das Verhalten nach und nach, ohne Zwang.
Rückfälle werden in IFS nicht als Scheitern gewertet, sondern als Botschaften. Sie zeigen, dass etwas im Inneren zu schmerzhaft war oder dass ein Verbannter zu nahe kam und Schutz brauchte. So können Rückfälle zu wichtigen Hinweisen werden und eine Brücke zur Heilung darstellen, statt Scham und Schuld zu verstärken.
Sucht ist in erster Linie ein Beziehungsproblem zwischen inneren Anteilen. Heilung bedeutet, die Absicht der süchtigen Teile zu würdigen, sie in Kontakt mit dem Selbst zu bringen und ihnen neue Aufgaben zu ermöglichen. Abstinenz entsteht dann oft ganz natürlich – nicht als Zwang, sondern als Folge eines stabileren, innerlich verbundenen Systems.
